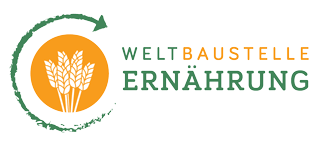Omar Aboubakar, Somalia. Wohnort heute: Goslar
Der Traum von Olympia
Omar Aboubakar flieht aus Somalia, weil er in dem von Krisen geplagten Staat am Horn von Afrika aufgrund seiner ethnischen Herkunft verfolgt wird. Aus Fischern und Tauchern wie Aboubakar werden am Horn von Afrika Flüchtlinge und Kriminelle – auch weil in Europa der Fisch schön billig sein soll.
Omar Aboubakar lebte mit seiner Familie auf Chula Island, einer Insel vor der Küste Somalias. Sie lebten von dem, was das Meer ihnen gab. Die Familie gehört zur sehr kleinen ethnischen Minderheit der Bajuni. „Für uns gibt es da keine Rechte“, sagt Omar Aboubakar, keine Schulen, keine Hilfe, keine Krankenhäuser, nichts. Immer wieder wurden sie angegriffen, von anderen somalischen Volksgruppen oder von radikal-islamistischen Gruppen. Omar Aboubakar hatte schon öfter daran gedacht, die Insel, das Land zu verlassen. Irgendwohin, nur fort. An einem Tag im Jahr 2008, als Omar Aboubakar zurück zu seinem Haus kam, waren die Verwandten fort, seine Mutter, seine Geschwister. Wieder war das Dorf überfallen worden, ein Nachbar sagte, dass seine Familie fliehen konnte. Wohin, wusste er nicht. Omar Aboubakar wartete zwei Wochen, aber seine Verwandten kamen nicht zurück. Er wusste, dass seine Mutter Goldschmuck versteckt hatte. Damit bezahlte er einen Mann, der ihm versprach, ihn in ein sicheres Land zu bringen. „Ein guter Ort, keine Angst, Frieden.“ Das reichte ihm, das Land war ihm egal.
Der Mann aus Somalia lebt plötzlich am Nordpol - und soll von dort nach Kenia abgeschoben werden
 Omar Aboubakar ging erst nach Mombasa, versteckte sich zwei Wochen in Nairobi, dann weiter mit dem Flugzeug. Das brachte ihn schließlich nach Schweden, das sollte also das sichere Land sein. Dort fuhr er weiter bis nach Kiruna, in die nördlichste Stadt Schwedens, buchstäblich am Nordpol. Der Mann, der bis dahin selten Temperaturen unter 20 Grad erlebt hatte, lebte nun also an einem der kältesten Orte der Erde. Dort hoffte er auf Asyl und einen Neustart. Aber stattdessen stand: Stillstand. Omar Aboubakar bekam keine Arbeitserlaubnis und durfte nicht zur Schule gehen. Bei einem Interview der Ausländerbehörde sagte man ihm, er stamme aus Kenia. Die Behörde hatte zwei Sprachwissenschaftler beauftragt, die seinen Swahili (Suaheli)-Dialekt aus dem Süden dem Swahili Kenias zuordneten. Dass auch in Somalia Menschen Swahili sprechen, wenn auch nur wenige Tausend, das ist den Behörden offensichtlich nicht bekannt. Omar Aboubakar nimmt einen Anwalt, besorgt Gegengutachten, die Behörden bleiben hart. „Sie wollten ihren Fehler nicht eingestehen“, sagt er. Nun war der Flüchtling in Schweden also nicht mehr geduldet, bekam kein Geld mehr, man wollte ihn sogar nach Kenia abschieben. Die kenianischen Behörden aber stellten sich quer. Schließlich fuhr Omar Aboubakar mit dem Zug nach Deutschland. Nach Aufenthalten in Hamburg, Köln, Wuppertal und Braunschweig landete er im Harz. Hier darf er bleiben, nachdem zwischenzeitlich die Abschiebung nach Schweden drohte.
Omar Aboubakar ging erst nach Mombasa, versteckte sich zwei Wochen in Nairobi, dann weiter mit dem Flugzeug. Das brachte ihn schließlich nach Schweden, das sollte also das sichere Land sein. Dort fuhr er weiter bis nach Kiruna, in die nördlichste Stadt Schwedens, buchstäblich am Nordpol. Der Mann, der bis dahin selten Temperaturen unter 20 Grad erlebt hatte, lebte nun also an einem der kältesten Orte der Erde. Dort hoffte er auf Asyl und einen Neustart. Aber stattdessen stand: Stillstand. Omar Aboubakar bekam keine Arbeitserlaubnis und durfte nicht zur Schule gehen. Bei einem Interview der Ausländerbehörde sagte man ihm, er stamme aus Kenia. Die Behörde hatte zwei Sprachwissenschaftler beauftragt, die seinen Swahili (Suaheli)-Dialekt aus dem Süden dem Swahili Kenias zuordneten. Dass auch in Somalia Menschen Swahili sprechen, wenn auch nur wenige Tausend, das ist den Behörden offensichtlich nicht bekannt. Omar Aboubakar nimmt einen Anwalt, besorgt Gegengutachten, die Behörden bleiben hart. „Sie wollten ihren Fehler nicht eingestehen“, sagt er. Nun war der Flüchtling in Schweden also nicht mehr geduldet, bekam kein Geld mehr, man wollte ihn sogar nach Kenia abschieben. Die kenianischen Behörden aber stellten sich quer. Schließlich fuhr Omar Aboubakar mit dem Zug nach Deutschland. Nach Aufenthalten in Hamburg, Köln, Wuppertal und Braunschweig landete er im Harz. Hier darf er bleiben, nachdem zwischenzeitlich die Abschiebung nach Schweden drohte.
Omar Aboubakars Fall ist bis heute in Schweden ein Thema, für viele ist es ein Skandal und ein Zeichen, wie das eigentlich doch so liberale Land seine Werte verschiebt. Anfang Februar ist ein schwedisches TV-Team nach Goslar gereist, um zu berichten, wie es ihm seit der zweiten Flucht aus Schweden ergangen ist. „Schweden hat sich nicht bei mir entschuldigt“, sagt der 44-Jährige. 2015 wurde sein Fall sogar im schwedischen Parlament besprochen. Mit einem Anwalt prozessiert er weiter gegen das Unrecht, das ihm widerfahren ist, sie wollen eine Entschädigung erreichen. „Wir gehen bis zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, wenn es sein muss“, sagt Omar Aboubakar. Er glaubt, dass die Behörden dort längst wüssten, dass sie einen Fehler gemacht haben – diesen aber nicht eingestehen wollen.
Wenn Omar Aboubakar allein ist, kommen die schlechten Gedanken
Die Reporter aus Schweden werden keine Erfolgsgeschichte senden können. Omar Aboubakar ist von seiner Flucht traumatisiert. Nach dem Trauma in der Heimat erleidet er in Schweden das zweite Trauma. Heute ist er in Goslar in Behandlung, er ist stabiler, es geht ihm besser als bei den ersten Sitzungen mit seiner Psychotherapeutin. Morgens besucht er jetzt die Sprachschule, das sei eine gute Zeit, sagt Omar Aboubakar. Dann fährt er mit dem Bus nach Hause, in ein Flüchtlingsheim außerhalb der Stadt, isst etwas, und fährt dann zurück. Meist verbringt er den Rest des Tages bei McDonald's. Er lernt dort bei einem Cheeseburger, trifft auch immer Menschen, die ihm bei einer Frage weiterhelfen können. Vor allem aber ist er dort nicht allein. Denn immer, wenn er allein ist, dann kommen die schlechten Gedanken. An die Flucht aus Somalia, an die Mutter, die im Vorjahr starb, an die Geschwister, von denen er nicht weiß, ob sie noch leben, an die Zeit in Schweden, die ihn so sehr zermürbte. Manche haben solche Erfahrungen nicht mehr ausgehalten. Ein guter Freund von Omar Aboubakar, ein Flüchtling aus Äthiopien, hat in Schweden Suizid gegangen. Der Mann, der nicht schwimmen konnte, ging in einer Mittsommernacht in einen See und ertrank.
Die Gründe für Flucht und Piraterie liegen auf unseren Tellern
Die Gründe der Flucht von Omar Aboubakar sind vielfältig. Verfolgung, weil er einer Minderheit angehört, das ist die offenkundige. Aber dahinter stehen weitere. Bürgerkrieg, Kolonialfolgen, Korruption. Die Hilfen der Verneinten Nationen, die seien in seiner Region nie angekommen, sagt Omar Aboubakar. Auch europäische Fischereiflotten gehören dazu, weil sie mit dafür sorgen, dass viele stolze Fischer arbeitslos wurden – und aus manchen Piraten. Omar Aboubakar hat in Somalia als Fischer und Taucher gearbeitet. Die Fischgründe sind reich, eigentlich. Und doch sterben in Somalia Menschen an Hunger, in Afrika insgesamt sind es jedes Jahr Millionen. Denn heute sind viele Küstenregionen Afrikas überfischt, es werden dort also mehr Fische gefangen als die Fische Nachkommen zeugen können. Das liegt auch an den großen Fischfangflotten, Fabriken auf See, die den Fang direkt verarbeiten und einfrieren. Dazu gehören auch europäische Schiffe, etwa ein Drittel der unter EU-Flagge gefangenen Fische stammen aus Gebieten außerhalb der EU. Westafrika ist ein großes Raubbaugebiet dieser Industrie, die den europäischen Fischhunger bedient. Aber auch die Küste Somalias, für die seit so vielen Jahren niemand mehr Verantwortung trägt, weil es keine Regierung gibt, wird leergefischt.
Das sogenannte Ocean Grabbing zerstört die Umwelt, und es zerstört die Lebensgrundlage vieler Fischer*innen und Arbeiter*innen bei der Verarbeitung. Also suchen diese ihr Glück in den Städten, flüchten in andere Länder oder werden in die Piraterie getrieben. Die Zunahme der kriminellen Angriffe auf Schiffe nahm derart zu, dass die NATO-Staaten Militärschiffe am Horn von Afrika patrouillieren ließen.
Beim Sport gelingt das Vergessen – manchmal
 Tauchen im Meer, das geht im Harz nicht. Aber Omar Aboubakar geht dort in der Halle Schwimmen und Tauchen, er ist schon beim Hannover-Marathon mitgelaufen. Beim Sport kann er manchmal vergessen, was ihn alles bedrückt. Und dann ist da noch die Sache mit den Skiern: In Schweden schenkte ihm ein Freund ein paar Langlauf-Skier. Er stürzte sich also in das neue Hobby, durchfuhr die Wälder Nordschwedens. Auch im Harz läuft er weiter. Und hatte einen Traum: Olympia. Er versuchte alles, klapperte die Botschaften ab, schrieb sogar dem IOC. Letztlich klappte es aber nicht, die Olympischen Winterspiele 2018 im südkoreanischen Pyeongchang finden ohne den Mann aus Somalia statt. „Ich bin sehr traurig“, sagt Omar Aboubakar. Er hätte gerne bei den Spielen auf seine Situation aufmerksam gemacht, weiß, dass ein Skisportler aus Somalia bei Olympia eine gute Geschichte für die Medien gewesen wäre. Vielleicht schaut er die Wettkämpfe im Fernsehen an. Seinen Körper muss er gerade schonen. Er hat soviel trainiert, dass das Knie gereizt ist. Er hatte die Schmerzen, die Warnzeichen des Körpers, einfach nicht gehört, so sehr ist der Kopf mit der Vergangenheit beschäftigt.
Tauchen im Meer, das geht im Harz nicht. Aber Omar Aboubakar geht dort in der Halle Schwimmen und Tauchen, er ist schon beim Hannover-Marathon mitgelaufen. Beim Sport kann er manchmal vergessen, was ihn alles bedrückt. Und dann ist da noch die Sache mit den Skiern: In Schweden schenkte ihm ein Freund ein paar Langlauf-Skier. Er stürzte sich also in das neue Hobby, durchfuhr die Wälder Nordschwedens. Auch im Harz läuft er weiter. Und hatte einen Traum: Olympia. Er versuchte alles, klapperte die Botschaften ab, schrieb sogar dem IOC. Letztlich klappte es aber nicht, die Olympischen Winterspiele 2018 im südkoreanischen Pyeongchang finden ohne den Mann aus Somalia statt. „Ich bin sehr traurig“, sagt Omar Aboubakar. Er hätte gerne bei den Spielen auf seine Situation aufmerksam gemacht, weiß, dass ein Skisportler aus Somalia bei Olympia eine gute Geschichte für die Medien gewesen wäre. Vielleicht schaut er die Wettkämpfe im Fernsehen an. Seinen Körper muss er gerade schonen. Er hat soviel trainiert, dass das Knie gereizt ist. Er hatte die Schmerzen, die Warnzeichen des Körpers, einfach nicht gehört, so sehr ist der Kopf mit der Vergangenheit beschäftigt.
Die Zukunft, die wird nicht leicht, das weiß Omar Aboubakar. Er lernt jetzt weiter Deutsch, will dann eine Ausbildung machen, die Richtung sei ihm gar nicht so wichtig, irgendetwas, wo er helfen kann. Goslar ist jetzt seine Heimat, sagt er, auch wenn sich das für ihn nicht so anfühle wie für andere Menschen, die von Heimat sprechen. Seine Aufenthaltsgenehmigung geht erst einmal bis zum Jahresende. Hier will er jetzt weiterkommen, er muss ja nach vorne schauen, sagt er, denn in die eigentliche Heimat wird er wohl nie zurückkehren. „Selbst wenn in Somalia irgendwann Frieden herrscht, meine Volksgruppe wird weiter unterdrückt werden“, sagt er.
Text: Gerd Schild
Grafik: Verband Entwicklungspolitik Niedersachsen e.V.